Film über Zwangsarbeiterbesuch (21.06.2006)

Herzliche Gastgeschenke: Oberbürgermeister Eberhard David dürfte nach dem Empfang drei Kilo schwerer geworden sein
Von Manfred Horn
Es war eine aufregende Woche im September 2004, für die
Zwangsarbeiter, aber auch für diejenigen, die das Besuchsprogramm in
Bielefeld organisierten. Nach längerem Briefkontakt waren 23 ehemalige
Zwangsarbeiter »Ostarbeiter«, wie die Nationalsozialisten sie nannten
nach Bielefeld gereist. Offiziell eingeladen waren sie von der Stadt.
Nun, fast zwei Jahre später, ist ein 45-minütiger Film entstanden,
der diese Besuchswoche dokumentiert. »Erinnern und Begegnen«, so der
Titel, zeigt chronologisch Momente einer Reise in die Vergangenheit.
Entstanden ist der Film in einer Menge ehrenamtlicher Arbeit aus 14
Stunden Filmmaterial. Mit einer Amateurkamera gedreht und zu Hause
eingesprochen, ist vor allem durch die Arbeit von Fabian Waltersdorf
ein Stück sehenswerte Dokumentation über ein für Bielefeld historisches
Ereignis entstanden. Nie zuvor war eine Gruppe Zwangsarbeiter aus der
ehemaligen Sowjetunion. Und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen
sein, da die Gäste alt sind. Schon in den knapp zwei Jahren seit dem
Besuch sind einige aus der damaligen Gruppe verstorben.
Weißes Tuch für sauberen Weg
Der Film beginnt herzlich: Ein Bus rollt in die Stadt und spuckt
ein Haufen alter Männer und Frauen aus. Mitglieder und Freunde der
Bielefelder Sektion des Vereins Gegen Vergessen, für Demokratie
stehen vor dem Hotel bereit: Da wird gedrückt und der eine oder andere
Rollstuhl aufgeklappt. Neben aller Schwere, die das Thema dem Film
vorgibt, finden sich auch komische Elemente. Als Oberbürgermeister
Eberhard David die Gruppe empfängt, verwandelte er sich vom
anzuggestärkten Stadtoberhaupt einer deutschen Mittelstadt in ein
wandelndes Museum osteuropäischer Volkskunst: Denn die Gäste hatten
allerlei mitgebracht: Da wurden ihm aus Holz geschnitze und ziemlich
dunkel gebeizte Raubvögel überreicht. Oder aber ein selbstgebackenes
Brot. Schließlich zierte ein weißes Tuch, »damit ihr Weg immer so
sauber bleibt wie dieses Tuch«, wie die Schenkerin es formulierte. Und
Wladimir Timofejew wünschte dem Oberbürgermeister gleich auch mal einen
erfolgreichen Wahlkampf.
Der Film zeigt aber auch die Reise durch die Vergangenheit: Die
Gruppe machte sich auf zu den Orten, wo sie vor über 50 Jahren gegen
ihren Willen arbeiten mussten. Arntzen Landbau gibt es längst nicht
mehr, dennoch ist auf dem Gelände einiges wiederzuerkennen. Schwieriger
wird bei Dürrkopp. Als die Gruppe auf dem Gelände des heutigen BAJ
eintrifft, kann sich diejenigen, die damals hier arbeiteten, nur schwer
orientieren. Ein alter Plan hilft, zu erahnen, wo damals was stand.
Zuviel hat sich seitdem verändert. Die Gruppe besuchte auch das Gelände
der ehemaligen Friedrich-Wilhelms Bleiche in Brackwede. Die
Zwangsarbeiter verarbeiteten damals Stärke für die Bleiche. Da ist
ausgehungert waren, kamen sie auf die Idee, die Stärke zu essen.
Über 16.000 Zwangsarbeiter waren in Bielefeld im Einsatz, 550 starben
während des Einsatzes, weil sie von Bomben getroffen wurden oder
schlechte Ernährung sie erkranken und schließlich sterben ließ. So
nimmt der Film die Zuschauer auch mit an Orte des Gedenkens auf dem
Sennefriedhof und den Johannisberg. Der Film eignet sich, in der
politischen Bildung einzusetzen. Wer den Film ausleihen möchte, kann
sich mit dem Verein Gegen Vergessen, für Demokratie in Verbindung
setzen. Die russische Fassung des Films ist bereits an die Besucher in
der Ukraine, in Weißrussland, Lettland und Russland gegangen.
Der Film wird auch im Bielefelder Bürgerfernsehen, Kanal 21,
ausgestrahlt: Am 14. Juli um 19 Uhr und dann nochmals am 15. und 16.
Juli, jeweils 18 Uhr
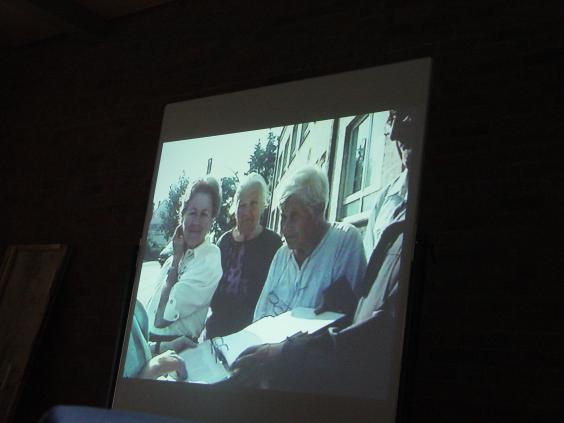
Rekonstruktion an Hand alter Pläne: Die Zwangsarbeiter suchten die Orte auf, an denen sie knechten mussten